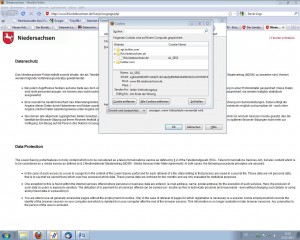Während man vor einigen Jahrzehnten die sog. informationelle Selbstbestimmung in Deutschland und Europa als (neues) zentrales Bürgerrecht definiert hat, formieren sich in letzter Zeit auch hierzulande die Post-Privacy-Propheten, deren Postulat lautet, dass wir die Kontrolle über unsere persönlichen Daten ohnehin längst verloren haben und dies nun auch endlich einsehen müssten. Sie nennen sich selbst die „datenschutzkritische Spackeria“ und hängen den Ideen von Marshall McLuhan an. Man gibt sich progressiv und bezeichnet die Datenschützer als konservativ und ideologisch.
Wer den Datenschutz als Ideologie betrachtet und gleichzeitig eine „Utopie“ als neues Modell verkaufen will, muss zumindest bei mir zunächst mit Skepsis rechnen.
Die Post-Privacy-Utopie leidet bei näherer Betrachtung auch unter einem kaum auflösbaren inneren Widerspruch, der sich sehr anschaulich anhand eines Interviews von Julia Schramm – sie ist eine der Protagonstinnen der Datenschutz-Spackos – verdeutlichen lässt. Gegenüber SPON erklärt Schramm wörtlich:
„Im Internet ist es eben vorbei mit der Privatsphäre, darüber sollte man sich klar sein. Schon der Begriff Datenschutz gaukelt eine falsche Sicherheit vor, die es praktisch nicht mehr gibt. Die einzige Alternative ist, anonym zu surfen.“
Hierin zeigt sich das Dilemma der Post-Privacy-Apologeten. Denn sie betrachten die Möglichkeit sich im Netz anonym zu bewegen als Selbstverständlichkeit, ohne zu erkennen, dass gerade dies bereits einen unmittelbaren Ausfluss des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung darstellt. Wer für sich das Recht reklamiert, anonym zu surfen, hat damit bereits anerkannt, dass es ohne die informationelle Selbstbestimmung nicht geht. Wer sie nicht mehr will, der muss auch auf die Möglichkeit verzichten, anonym zu surfen. Der Vorbehalt von Anonymität und die Vorstellung von absoluter Transparenz aller Daten sind nicht miteinander in Einklang zu bringen. Die Vorstellung von einer Gesellschaft, die keine Privatssphäre mehr kennt, atmet den Geist des Totalitarismus. Transparenz bedeutet Kontrolle. Aus diesem Grund muss der freiheitlich-demokratische Staat, der vom Spannungsverhältnis Staat-Bürger geprägt ist, dafür sorgen, dass die öffentliche Gewalt transparent agiert, während dem Bürger die größtmögliche Intransparenz zuzubilligen ist. Wer den gläsernen und transparenten Bürger fordert, steht deshalb in der Tradition der Unfreiheit, wie sie den Überwachungsstaaten eigen ist.
In letzter Konsequenz geht es um die uralte Frage, was der Mensch ist und was ihn ausmacht. Eine Werteordnung, die sich zu unveräußerlichen Menschenrechten bekennt, erkennt damit zugleich an, dass jeder Mensch das Recht haben muss, sich als Individiuum in Freiheit selbst zu verwirklichen. Unser Grundgesetz bezeichnet dies als Menschenwürde. Deren oberste Prämisse lautet, dass der Mensch keiner Behandlung ausgesetzt werden darf, die ihn zum bloßen Objekt degradiert. Aber genau darauf läuft die Forderung der datenschutzkritischen Spackeria hinaus. Wie viele andere zum Scheitern verurteilte Utopien davor, verkennt die Post-Privacy-Ideologie das Wesen des Menschen.
Man muss den Verfechtern von Post-Privacy allerdings eine in weiten Teilen zutreffende Zustandsbeschreibung zugute halten. Die derzeit geltenden Regeln des Datenschutzes werden im Netz fast zwangsläufig gebrochen, weil eine konsequente und enge Anwendung unseres jetzigen Datenschutzregimes mit der üblichen und allgemein praktizierten Nutzung des Internets nicht in Einklang zu bringen ist. Die berufsmäßigen Datenschützer haben in ihrem Elfenbeinturm weitgehend den Bezug zur Realität verloren. Ihre Ansätze, wie die unterschiedslose und unbedingte Qualifizierung von IP-Adressen als personenbezogende Daten oder die Vorstellung vom Hosting als eine den Anforderungen des § 11 BDSG unterliegende Auftragsdatenverarbeitung, sind nicht internetkonform. Würden sich diese Vorstellungen durchsetzen, dann würde dies das Ende des Netzes wie wir es kennen, bedeuten.
Man sollte sich allerdings davor hüten, aus einer zunächst (in Teilen) zutreffenden Zustandsbeschreibung vorschnell die falschen Schlussfolgerungen zu ziehen. Die Lösung kann nicht in einer Preisgabe des Datenschutzes bestehen, sondern nur in seiner Neudefinition. Das Recht des Individuums sich frei entfalten zu können, muss dabei erhalten bleiben. Auch denjenigen, die das Internet überhaupt nicht nutzen wollen und denjenigen, die es nur absolut anonym nutzen wollen und es ablehnen, irgendwelche personenbezogenen Daten, sei es bei Facebook oder anderso, im Netz zu hinterlassen, darf man keine Ordnung aufzwingen, die keine Privatheit mehr kennt. Ihr Recht, in Ruhe gelassen zu werden und sich so zu entfalten, wie sie es sich selbt vorstellen, ist zu respektieren und muss um jeden Preis geschützt werden. Und zu diesem Schutz ist der Gesetzgeber berufen.
Die Forderung der Datenschutz-Spackeria würde demgegenüber den Weg hin zu einer informationellen Fremdbestimmung ebnen. Sie ist deshalb Ausfluss einer illiberalen Geisteshaltung, der es entgegen zu treten gilt.